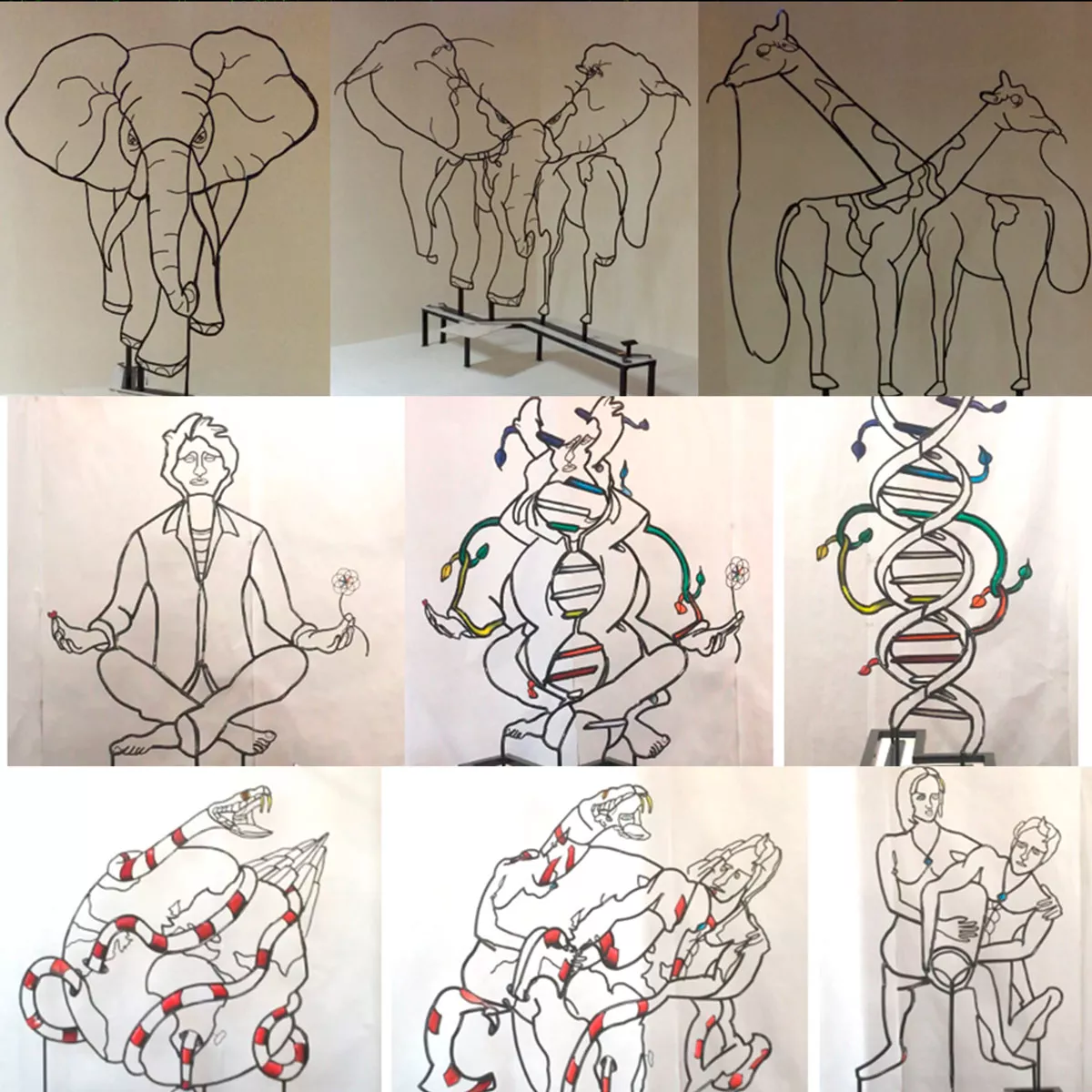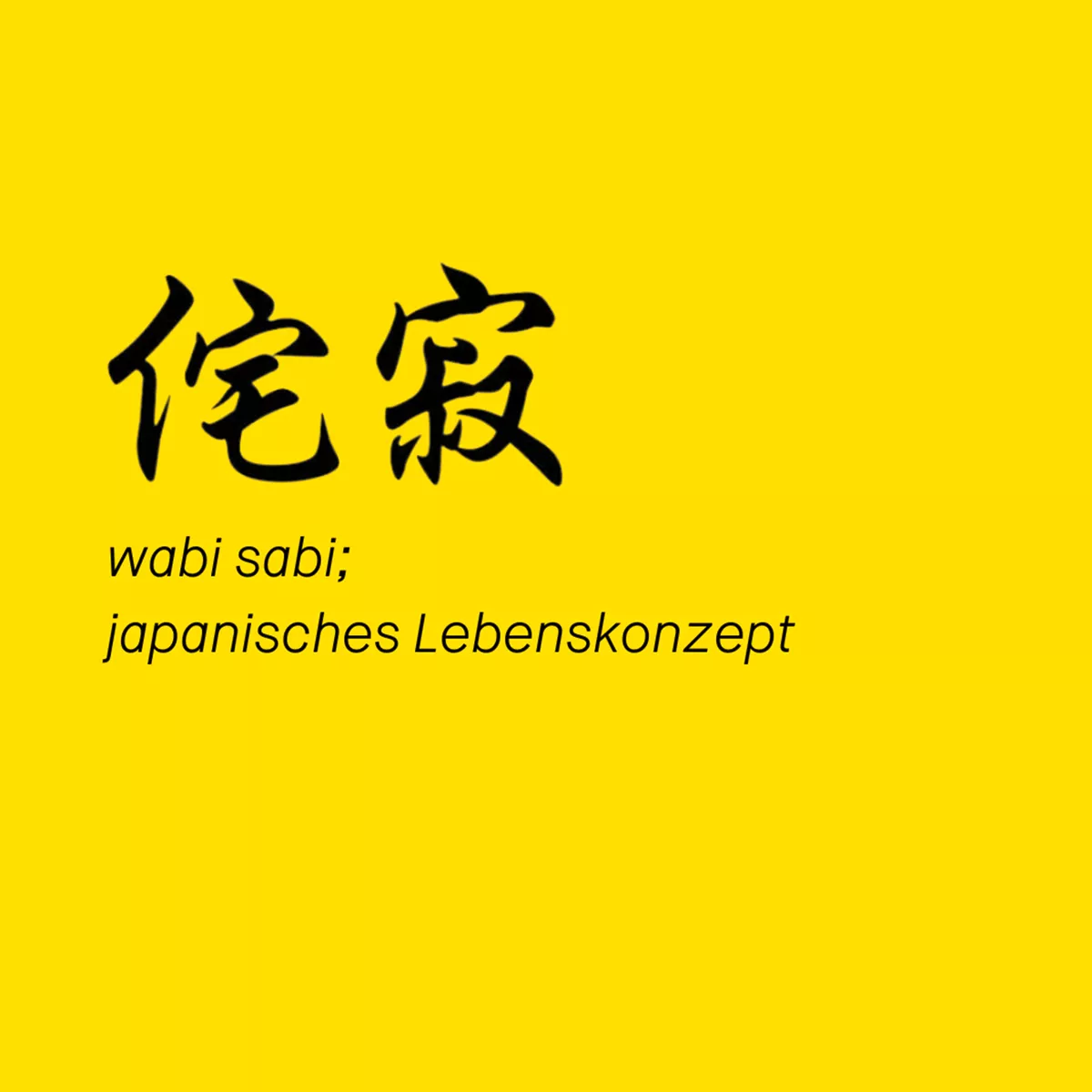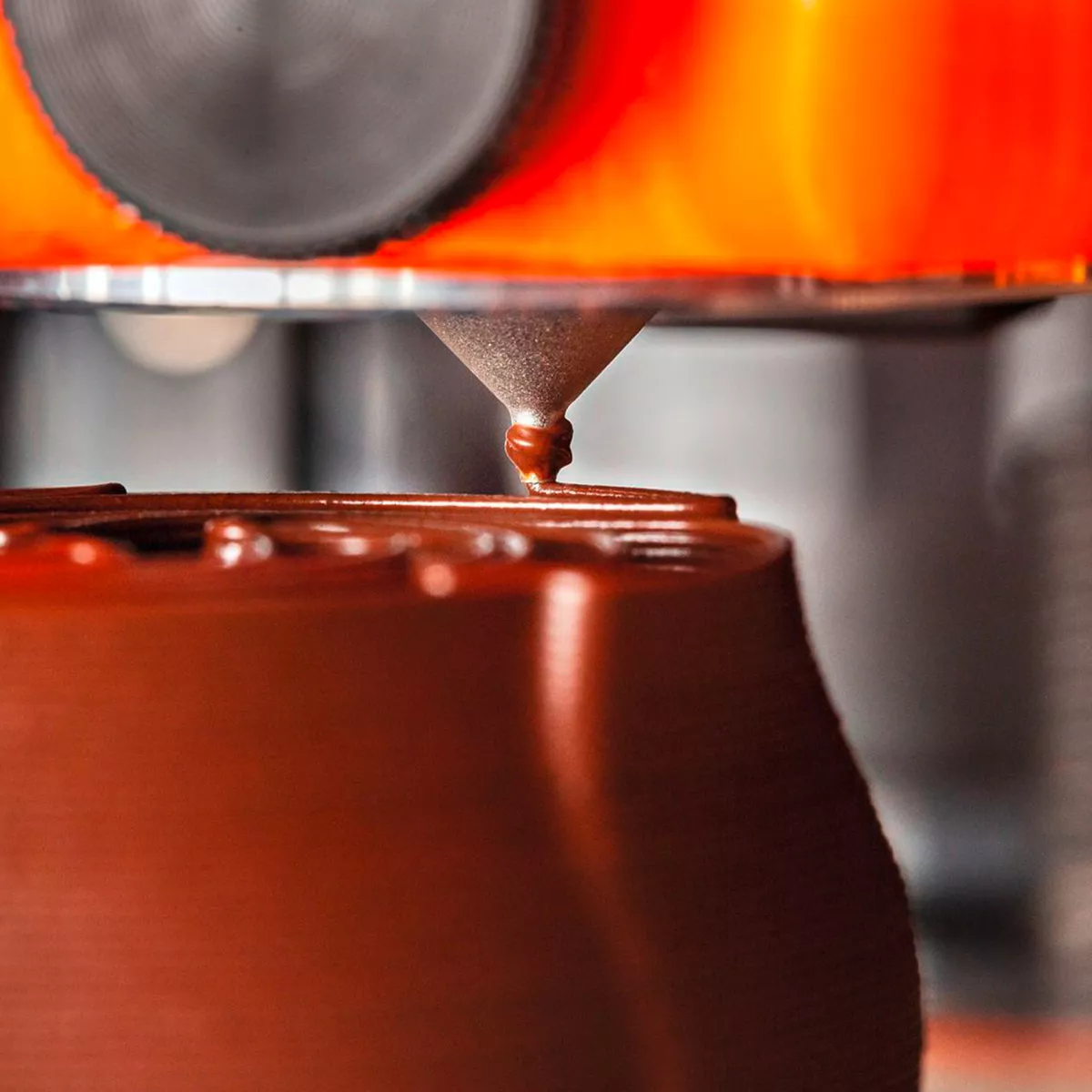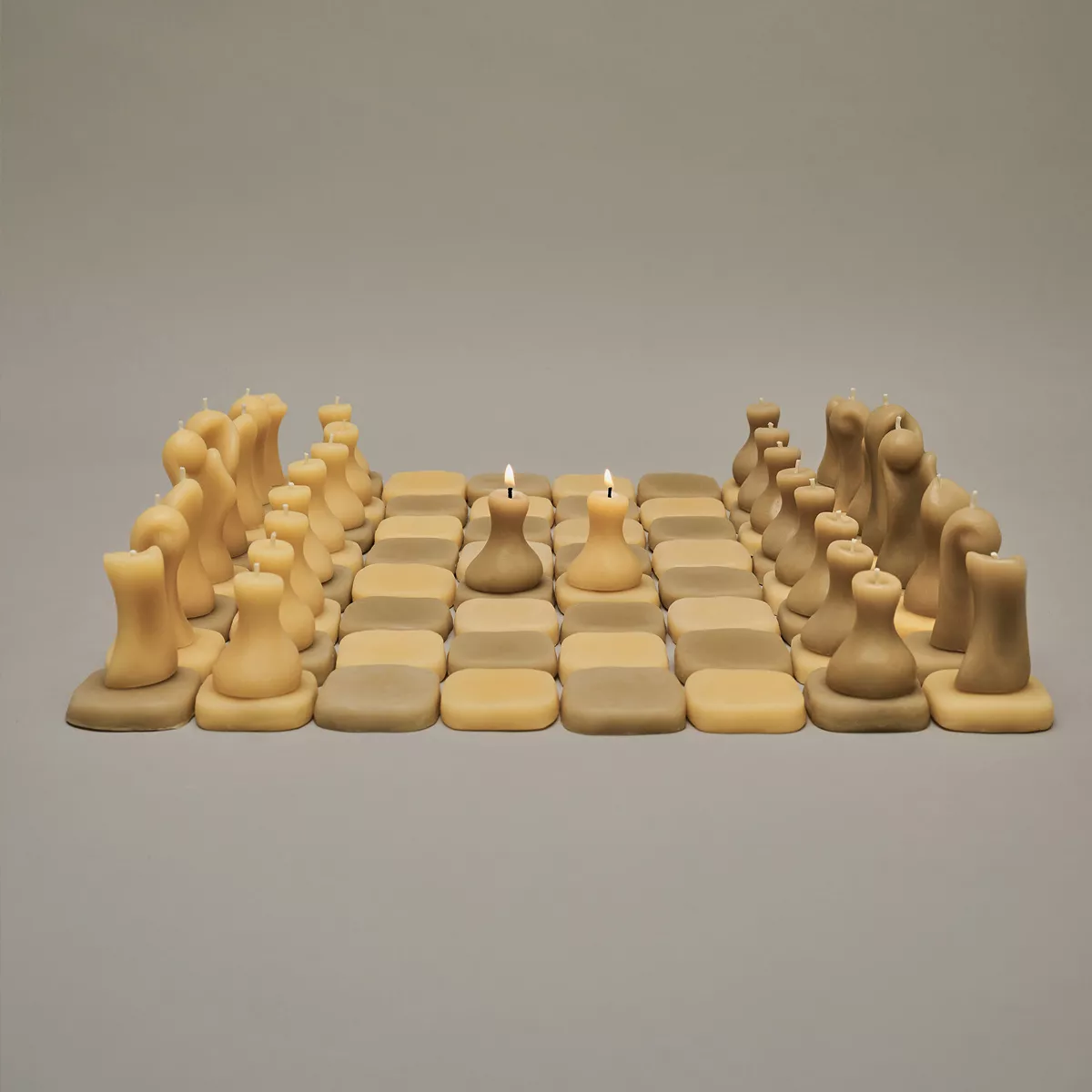In Zeiten von Tiny Houses, Herumreisen im ausgebauten Camper und minimalistischen Lebensstil erscheint das Wohnen im Baumhaus als echte Möglichkeit, Natur und Urbanität im Alltag zu vereinen.
Moderne Baumhäuser: Tiny Houses in Höhe
Mit der Gründung seines Unternehmen 2003 erfüllt der deutsche Pionier der Baumhaus-Architektur nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Kund:innen einen Traum aus Kindheitstagen: Architekt Andreas Wenning ist der Vater der Firma „baumraum“, mit der er seit Jahren zahlreiche Baumhaus-Projekten über Deutschland hinaus verwirklicht. Von privaten Refugien über Rückzugsorte in der Natur bis hin zu Hotels: Bei den von baumraum konstruierten Häusern handelt es sich um Unikate, dessen Design sich aus den Wünschen der Kunden, der zu integrierenden Natur und der Erfahrung des Teams formt.
Seine wohl bekannteste Baumhaus-Architektur heißt „Urban Treehouse“ und steht auf einem 650 qm großen Gartengrundstück in Berlin. Das Projekt umfasst zwei moderne Bauten mit Wohn- und Schlafraum, Küche, Badezimmer mit Regendusche und Terrasse. In einer Höhe von mehr als vier Metern und auf jeweils 21 qm Wohnfläche bieten sie damit alles, was auch andere Apartments beinhalten – inklusive Fernseher, W-LAN und Soundsystem. Auch wenn baumraum in der Lage ist, größere Häuser in der Höhe zu konstruieren, plädiert Architekt Wenning dafür, sich dem Charme einer klassischen Baumhaus-Architektur anzunehmen. Ganz im Sinne eines Tiny Houses sollen die Räumlichkeiten minimalistisch, praktisch und komprimiert gehalten sein.
Welche Bäume eignen sich für ein modernes Baumhaus?
Die Größe der Hütte ist natürlich abhängig von der Statik des Baumes, auf dem sie errichtet wird. Nicht immer ist es möglich, den Baum als alleiniges Tragwerk einzusetzen – wie auch beim „Urban Treehouse“. Hier wurde ein eigener „Stamm“ aus Holz als Fundament der Wohnfläche konstruiert. Gebaut wird vorrangig mit heimischen oder FSC-zertifiziertem Holz. Es können aber auch andere Materialien zum Einsatz kommen. So entlasten bei weiteren Baumhaus-Projekten Stahl-Stelzen Stamm und Wurzeln. Statt Schrauben und Bolzen nutzt das Unternehmen spezielle Gurte, um den Baum vor Krankheiten wie Pilzbefall zu schützen. Vorab entscheiden hinzugezogene Gutachter:innen über den Zustand des Baumes und dessen Fähigkeit, ein Haus über Jahrzehnte zu tragen. Im Hinblick auf die Langlebigkeit achten Wenning und sein Team darauf, dem lebenden Organismus als Teil der Konstruktion ungestörtes Wachstum zu ermöglichen. Das Erschaffen einer lebenden Baumhaus-Architektur dauert ungefähr vier bis neun Monate. Ob als neues Eigenheim, Spieleparadies für Kinder oder Arbeitsplatz mit Baumwipfel-Ausblick: Solche Baumhäuser können eine langfristige Investition in zusätzlichen und naturnahen Lebensraum sein – vor allem in Städten.
Baumhaus-Architektur im urbanen Raum
Die Zahl der Architekt:innen und Designer:innen, die sich mit dem Bau von modernen Baumhäusern in der Stadt beschäftigen, nimmt zu. Nicht ohne Grund; denn Eiche und Co. sollen als Teil des urbanen Wohnens betrachtet werden. Solche Konstruktionen ermöglichen in einer geschäftigen Metropole Abgeschiedenheit in der Natur, während beim Anblick von begrünten Zweigen das Wohlbefinden der Bewohner:innen zunimmt. Ähnlich wie beim Leben im Nomadenmobil ist auch das Wohnen in einer Baumhaus-Architektur eine Frage des Geschmacks und der Komfortansprüche. Doch egal, ob man dafür gemacht ist oder nicht: Diese Häuser inmitten von Grün können eine Bereicherung der gesamten Nachbarschaft sein. Durch die Integrationen von Baumhäusern in Grünflächen bleiben die Pflanzenanlagen erhalten und lassen inmitten der Betonwüste wortwörtlich Luft zum Atmen. Die architektonische Umsetzung eines Baumhaus-Projektes in der Stadt lässt jede Menge Raum für Kreativität: Einige sind klassisch um den Stamm eines Baumes herum konstruiert wie bei baumraum, während andere durch begrünte Dächer und baumbewachsene Fassaden den Begriff aus Tagen als Kind neu definieren.
Turins Treehouse
Um das Baumhaus für den dicht besiedelten Stadtraum massentauglich zu machen, hat Architekt Luciano Pia eine moderne Interpretation gefunden: „25 Verde“ besteht über seine fünf Stockwerke hinweg beinahe vollständig aus Holz und bietet auf seinen 7.500 Quadratmetern Platz für 63 Wohnungen inklusive Dachterrasse oder Balkon. An der mit Lärchenholz verkleideten Fassade reihen sich um die 150 Bäume und Pflanzen, die in stabilen, großen Töpfen auf den Balkonen und am Stahlgerüst des Baus platziert sind. Das begrünte Gebäude bildet einen wahren Kontrast zum ansonst tristen Industriegelände und wertet Turins Umgebung direkt optisch auf. Aber das Haus bietet mehr als eine beschauliche visuelle Komponente: Die integrierten Fassadenpflanzen nehmen in der Stunde rund 200.000 Liter Kohlendioxid auf, was einen direkten Einfluss auf das Mikroklima nimmt. Zudem regulieren sie die Raumtemperatur im Inneren: Sie spenden im Sommer Schatten und lassen im Winter das warme Licht in den Wohnraum. Wie eine Art Klimaanlage fungieren auch die Bäume im Innenhof. Ein weiterer Vorteil: die begrünten Wände schlucken Lärm.
Brasiliens baumtragender Gigant
Inmitten der grauen Megametropole São Paulo lässt Architekt und Pulitzer-Preisträger von 2008 Jean Nouvel in Zusammenarbeit mit Unternehmer Alexandre Allard ein Hochhaus mit Bäumen entlang der Fassade entstehen: Mata Atlântica Tower, wie der Pflanzenturm heißt, ist Teil der 45.000 Quadratmeter großen grünen Oase namens Cidade Matarazzo. Mit der Intention, ein Leitbild für unverzichtbares Umweltbewusstsein in Brasilien zu schaffen, rief Alexandre Allard das Projekt ins Leben. Die Pflanzen-Enklave schlug nicht nur horizontal, sondern mit dem Wolkenkratzer auch vertikal Wurzeln: Der Turm ist Ebene für Ebene mit bis zu 14 Meter hohen Bäumen bestückt. Insgesamt ist er mehr als 300 Meter hoch und prägt die Skyline der Stadt.
Am gewünschten Leitbild ausgerichtet wurden Designelemente im Sinne der Nachhaltigkeit konzipiert. Das Gebäude kommt mit ausschließlich erneuerbaren Energien aus, ist so geformt und ausgerichtet, dass Bewohner:innen das natürliche Licht möglichst lange nutzen können und das den Energieverbrauch senkt. Zudem verfügt das Gebäude über eine Regenwassersammelanlage und ein Grauwasser-Recycling-System.
Auch wenn Pflanzentürme wie in São Paulo oder Turin auf den ersten Blick nicht der romantischen Vorstellung eines Baumhauses entsprechen, besitzen sie ähnliche Eigenschaften: Sie steigern das Wohlbefinden, verbessern das Mikroklima, isolieren Wärme, Kälte als auch Lärm und bieten direkte Naturnähe. Dennoch hat das gigantische Baumhaus 2.0 als grüne Architektur entscheidende Vorteile im urbanen Raum: Die Hochhäuser brauchen in dicht besiedelten Städten wenig Fläche und bieten gleichzeitig beliebten Wohnraum. Tragen die Fassaden auch noch vertikale Gärten, kann die Luftqualität und das oftmals aufgeheizte Stadtklima weitreichend verbessert werden.
Zwillingstürme mit Garten-Fassade
Und auch diese urbane Baumhaus-Architektur zeigt, dass für eine moderne Interpretation kein Garten notwendig ist. 2014 stellte Architekt Stefano Boeri die zwei begrünten Zwillingstürme zu Ende, die unter dem Namen „Bosco-Verticale“ bekannt sind. Damit war das erste moderne Baumhochhaus in Europa geboren. Die je 80 und 112 Meter hohen Wohntürme stehen im Stadtviertel Porta Nuova (Mailand) und bilden mit ihren zahlreichen Balkonen die Basis für 800 Bäume und über 20.000 Pflanzen. Ein Design, das die Pflege des vertikalen Waldes nicht so einfach macht. Die Lösung: Fliegende Gärtner:innen, die in luftiger Höhe angeseilt die Pflanzen gießen und Bäume beschneiden.
Auch wenn die Begrünung nachhaltig ist, ist das Material weniger ökologisch: Die Bauten bestehen nämlich zu großen Teilen aus Beton. Dennoch ist das Design bemerkenswert: Schließlich handelt es sich bei „Bosco-Verticale“ um Gebäudebegrünung im Großformat. Ziemlich modern, wenn man bedenkt, dass diese Baukunst im nächsten Jahr sein Zehnjähriges feiert.
Nach dem Mailänder Vorbild wird seit 2016 auch in China zwei Pflanzentürme geschaffen – natürlich wieder von Boeri und seinem Team: „Nanjing Vertical Forest“ – wie der Name bereits verrät, stehen die Hochhäuser im Bezirk Ninjing Pukou, China. Von unten bis oben bewaldet bieten sie eine riesige Fläche, schließlich sind sie 200 und 108 Meter hoch. Damit fungieren nicht nur die Türme in Mailand als gigantische Luftreiniger: Mit über 800 Bäumen und 2500 Pflanzen sollen auch in der chinesischen Großstadt jedes Jahr bis zu 16,5 Tonnen Sauerstoff produziert werden. Durch die Anpflanzung von 27 einheimischen Arten trägt der Bau zudem zur Regeneration der lokalen Artenvielfalt bei.

Judith liebt das Leben mitten in der Metropole Köln. Ihr Gespür für spannende Storys führt sie regelmäßig zu außergewöhnlichen Themen mit aktuellem Zeitgeist. Schon seit ihrer Kindheit folgt sie ihrer Passion, dem Schreiben; seit zwei Jahren nun auch als Redakteurin. Besonders begeistern sie die Themen Psychologie, DIY und Yoga. Bereiche, über die sie als Online-Redakteurin schreibt und die sie gerne ihrer Freizeit ausübt. Ein Gespür für ästhetische Einrichtung besitzt sie bereits seit ihrem Studium im Bereich Design. Seither entdeckt sie immer wieder neue Design-Innovationen und einzigartige Architekturen, über die sie auf kronendach berichtet.