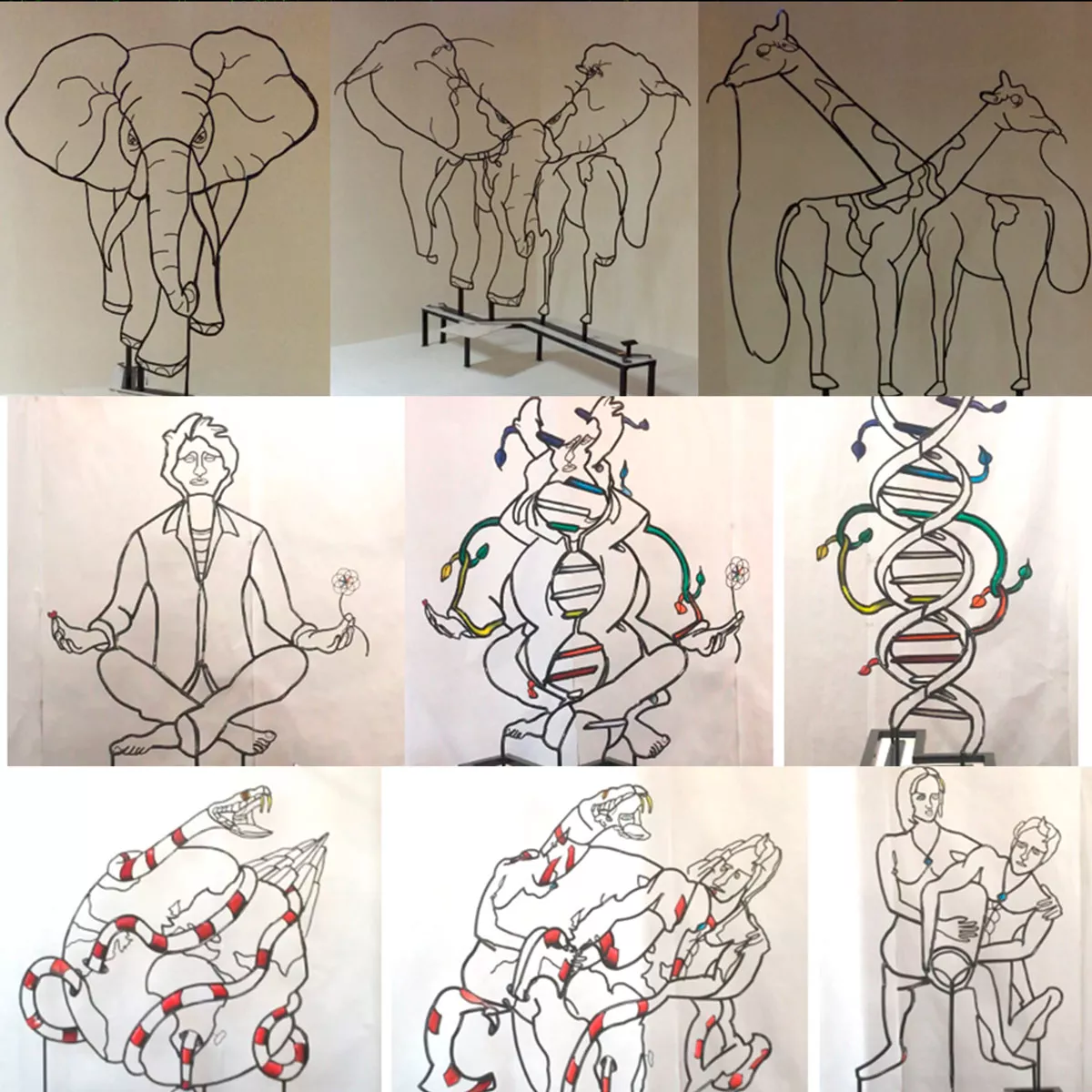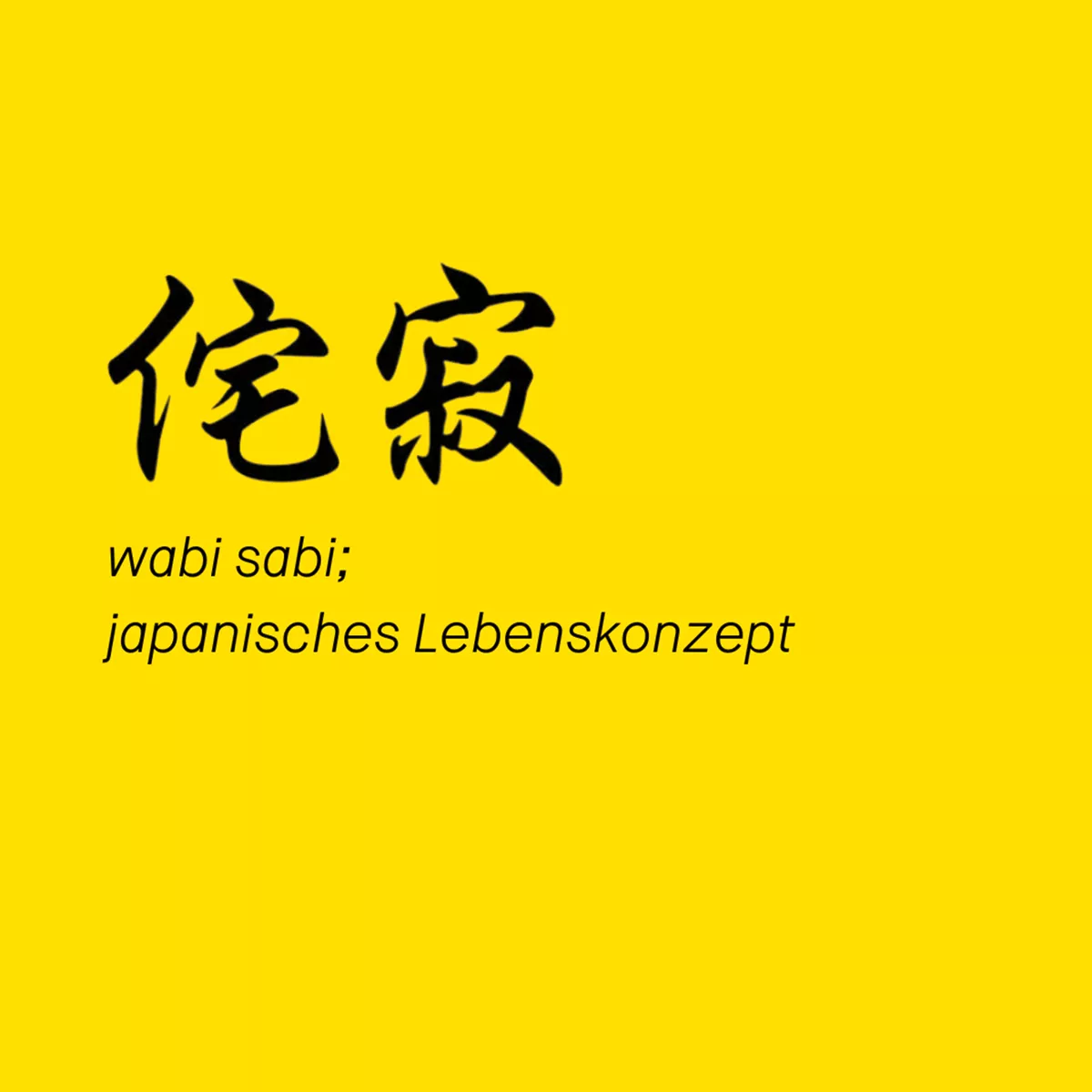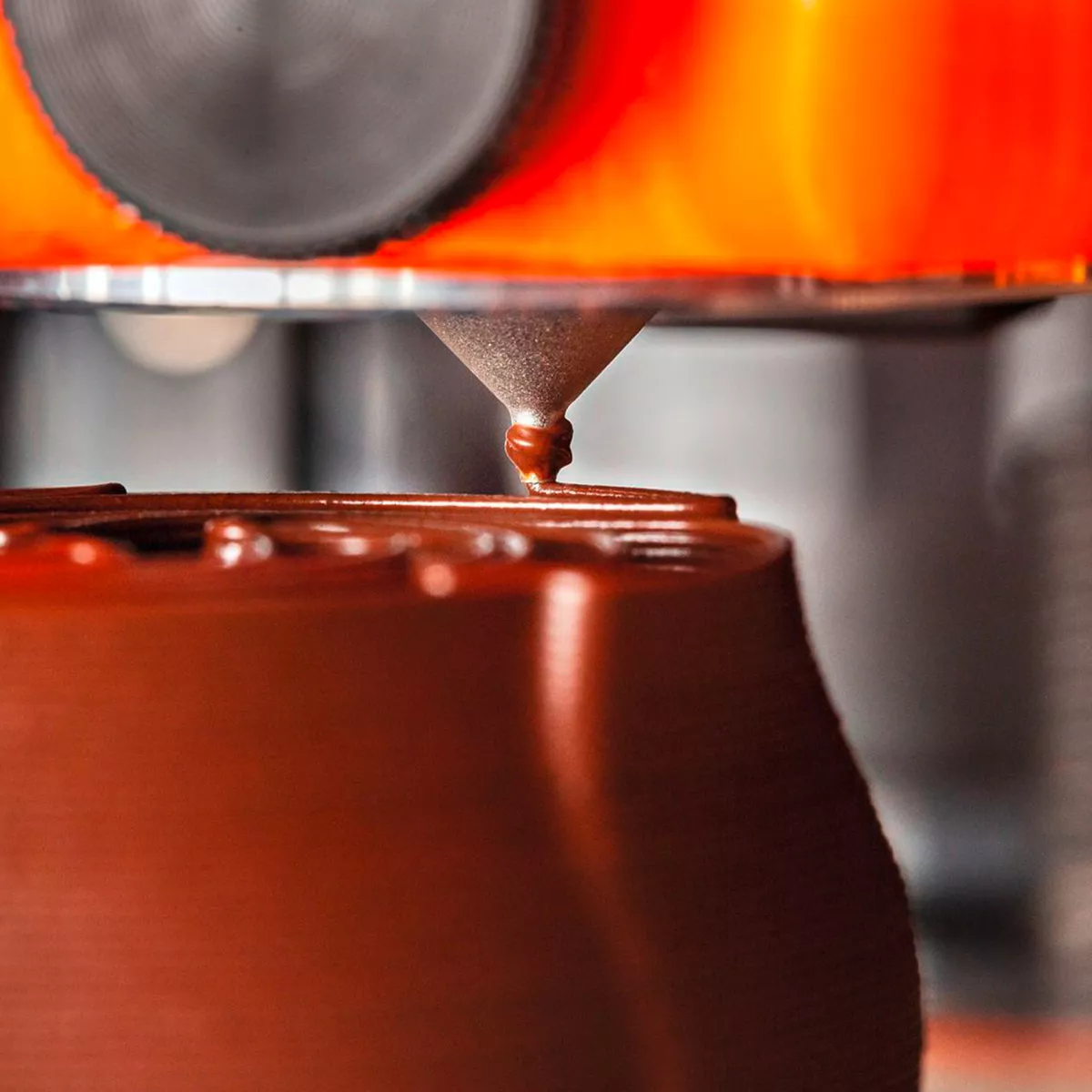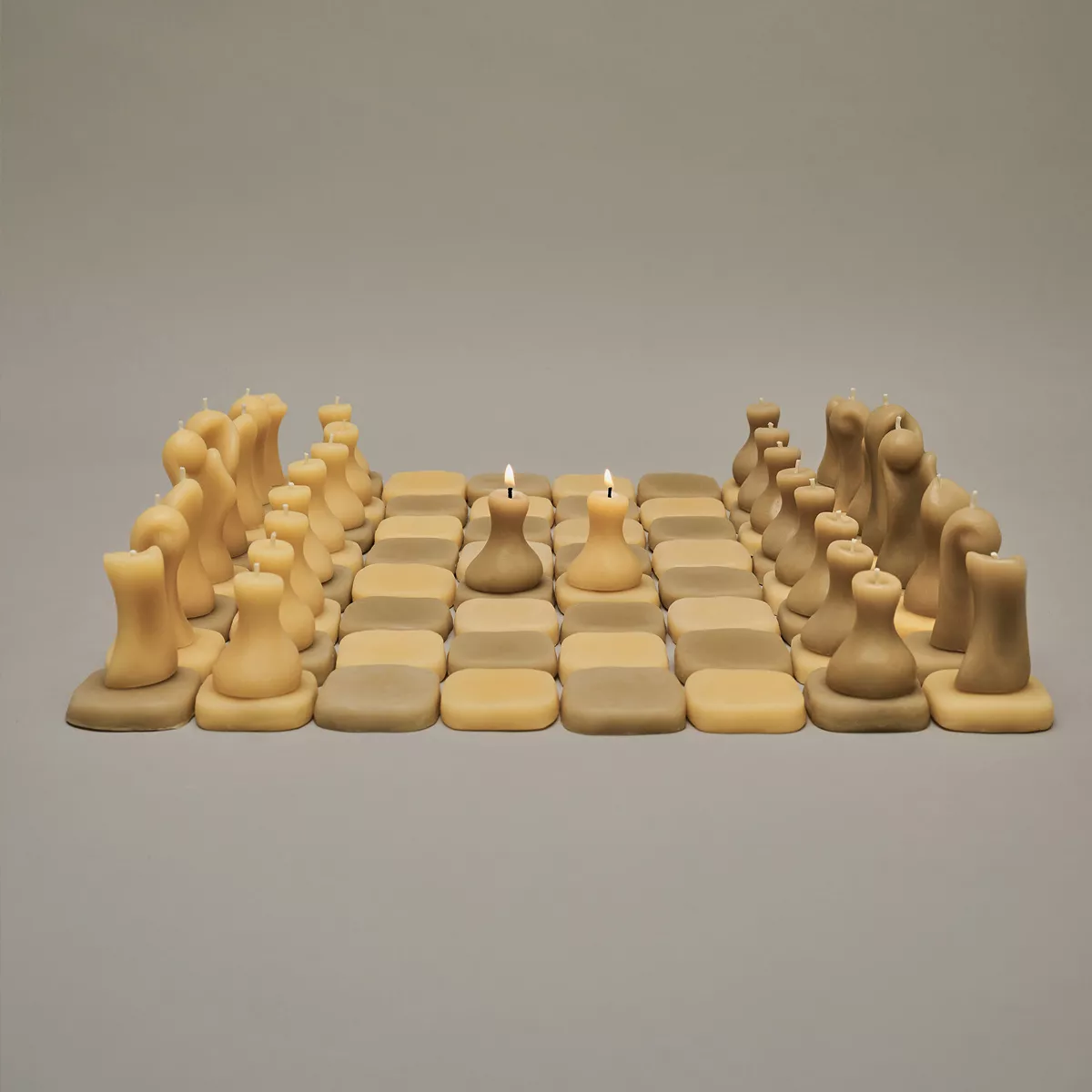Mehrere Milliarden Tonnen Müll produziert die Menschheit jedes Jahr. Was tun, wenn der Müllberg immer größer wird? Projekte in Japan, Deutschland, Finnland und Indonesien zeigen bereits heute, wie das Recycling der Zukunft aussehen kann.
Zu viel Müll, aber keinen Weg, ihn zu entsorgen: Vor diesem Problem stand die kleine Stadt Kamikatsu in Japan. Bis in die frühen 2000er Jahre haben die Bewohner:innen ihren Müll einfach verbrannt. Doch neue Regulationen der Regierung Japans ließen das nicht mehr zu. Also haben sich die rund 1.400 Einwohner:innen von Kamikatsu vor 20 Jahren das Ziel gesetzt, bis 2030 abfallfrei zu sein, also ihren Müll zu hundert Prozent wieder zu verwerten.
Das Recyclingdorf Kamikatsu in Japan
Ihr Vorhaben zeigt bereits Erfolg: Heute weist das Dorf eine Recycling-Quote von rund 80 Prozent auf, der Rest des Mülls landet noch auf der Müllhalde. Zum Vergleich: In ganz Japan liegt die Recycling-Quote bei nur 20 Prozent. Das schaffen die Bewohner:innen von Kamikatsu durch ein kompliziertes System und strenge Regeln zur Trennung des Mülls. In 45 verschiedene Tonnen sortieren sie ihren Abfall. Kartons werden von Büchern getrennt, Zeitschriften von Zeitungen, Plastik wird gewaschen, Verpackungen zur Not von Hand auseinander geschnitten. An die Müllsammelstelle ist ein Hotel angeschlossen, an der Rezeption kann gekauft werden, was die Bewohner:innen der kleinen Stadt ausrangiert haben. Zum Beispiel Altglas, das ein anderer vielleicht für ein Upcycling-Projekt gebrauchen kann, oder Batterien, die noch nicht ganz leer sind.
Das Zero-Waste-Konzept zieht sich durch die ganze Stadt. Unter anderem gibt es einen Zero-Waste-Laden in Kamikatsu und das acht Meter hohe Gemeinschaftszentrum der Stadt ist mit ausrangiertem Müll ausgestattet. Als Bodenbelag dienen alte Fliesen aus einer verlassenen Fabrik, gereinigte Flaschen wurden zu Kronleuchtern umfunktioniert, die Wände mit Zeitungspapier verkleidet. In einer Tauschbörse können die Bewohner:innen von Kamikatsu gebrauchte Gegenstände tauschen, außerdem gibt es in der Stadt eine Fabrik, in der Frauen Taschen und Klamotten aus ausrangierten Kleidungsstücken nähen. Die Einrichtungen werden von der lokalen Non-Profit-Organisation Zero-Waste-Academy verwaltet, sie bietet auch Kurse zur Trennung von Müll an. Mittlerweile ist Kamikatsu in ganz Japan bekannt, selbst Menschen aus anderen Ländern der Welt reisen hierher. Sie wollen sich selbst ein Bild davon machen, wie wir innovativer mit Müll umgehen können – um so der Umwelt etwas Gutes zu tun.
Klimaneutraler Kraftstoff aus Speisefett
Auch Forschende der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften haben einen Weg gefunden, innovativer mit Müll umzugehen: Mit ihrem Projekt READi-PtL stellen sie aus altem Speisefett synthetischen Kraftstoff her. Die Abkürzung READi-PtL steht dabei für Reactive Distillation Power to Liquid (Reaktivdestillation Energie zu Flüssigkeit).
Die Forschenden haben eine Anlage entwickelt, die altes Speisefett vorwärmt, rührt, dabei homogenisiert und dann in einen Reaktor pumpt. Bei Temperaturen zwischen 350 und 400 Grad Celcius werden die Kohlenwasserstoffatome des Fetts aufgebrochen. So entsteht Bio-Rohöl, dass zu künstlichem Diesel weiterverarbeitet wird. Mit diesem Kraftstoff können Autos und LKWs betankt werden.
Zwei Tonnen Kraftstoff pro Woche werden schon aus der Anlage gewonnen. Das Speisefett liefert aktuell das schleswig-holsteinische Entsorgungsunternehmen KBS (Krebs Brüggen Sekundärrohstoffe/Großenaspe). In Zukunft könnte auch Plastikmüll als Ausgangsstoff genutzt werden.
Das Besondere an der Anlage ist ihre Energieeffizienz: Nur eine Kilowattstunde Strom wird für die Herstellung von einem Liter Kraftstoff benötigt. Das bedeutet, ein Auto kann mit einem Energieaufwand von fünf Kilowattstunden Strom 100 Kilometer weit fahren. Was zurzeit noch ein Pilotprojekt ist, soll schon bald kommerziell genutzt werden: Das Hamburger Unternehmen Nexxoil will bis Ende des Jahres eine erste Produktionsstätte für den klimaneutralen Kraftstoff bauen.
Batterien aus Abfall der Zellstoffherstellung
Auch das schwedisch-finnische Forstunternehmen Stora Enso macht vor, wie aus einem Abfallprodukt ein neuer Rohstoff gewonnen werden kann. Sie stellen aus Lignin den biobasierten Hartkohlenstoff Lignode her. Lignin ist ein Makromolekül, das in der Holzzellwand von Bäumen vorkommt. Werden Bäume gefällt, um daraus Zellulosefasern herzustellen, wird das Lignin vom Holz getrennt. Stora Enso verarbeitet das vermeintliche Abfallprodukt dann zu feinem Kohlenstoffpulver, aus dem sie wiederum Elektrodenplatten- und rollen herstellen. Diese Elektrodenplatten- und rollen werden schließlich mit positiven Elektroden, Separator, Elektrolyt und weiteren Komponenten zu einer Lithium-Ionen-Batterie zusammengefügt.
Lignode kann das Graphit in Lithium-Ionen-Batterien ganz oder teilweise ersetzen. So entsteht aus Abfall ein Rohstoff, der einen zusätzlichen Mehrwert aus den geernteten Bäumen generiert und das Batteriegeschäft ein Stück weit nachhaltiger macht. Denn Graphit ist ein fossiler Kohlenstoff, dessen Abbau im Bergbau unter sozial und ökologisch kritischen Bedingungen stattfindet.
Das Holz, das Stora Enso für die Produktion von Zellulosefasern nutzt, stammt aus zertifizierten europäischen Wäldern. In ihrem Werk in Finnland stellt das Unternehmen jährlich 375.000 Tonnen Zellstoff her. Kürzlich wurde das Werk durch die Pilotanlage ergänzt, in der das Lignin seither zu Lignode verarbeitet wird.
Project Wings baut aus Plastikmüll das größte Recyclingdorf der Welt in Indonesien
Die NGO Project Wings baut indes unweit des Gunung-Leuser-Nationalparks auf Indonesiens Insel Sumatra ein ganzes Dorf aus Plastikmüll. Das „größte Recyclingdorf der Welt“, wie sie es nennen, entsteht auf einer drei Hektar großen Fläche innerhalb des kleinen Städtchens Bukit Lawang. Hinter einem Zaun gibt es hier eine Bibliothek, eine Schule, eine überdachte Sporthalle, einen Marktplatz und ein Co-Working-Büro.
Erbaut sind diese Gebäude aus tausenden Plastikflaschen, dich sich zwischen einem Gerüst aus Bambus und einer Schicht aus Lehm aneinanderreihen. Über 100.000 Flaschen sind hier schon verbaut. Die Flaschen sind vollgestopft mit Plastikmüll; und zwar so voll, dass sie rund ein halbes Kilo schwer, stabil und hart sind. Ecobricks heißen diese innovativen Ökobausteine. Die Ecobricks werden von Einheimischen aus den umliegenden Gemeinden hergestellt. Sie sammeln Müll, waschen ihn und stellen daraus die ökologischen Bausteine her. Für jeden Ecobrick erhalten sie 5.500 indonesische Rupiah. Das sind umgerechnet rund 40 Cent, was dort für eine warme Mahlzeit ausreicht.
Project Wings wurde 2019 von Sebastian Keilholz, Marc Helwing, Leonie Deimann und Erich Stieb aus Deutschland gegründet. Vor Ort wird das Projekt komplett von Einheimischen geführt, rund 50 Menschen sind in Indonesien für Project Wings angestellt. So wächst das Recyclingdorf Plastikflasche um Plastikflasche immer weiter. Der Ort soll auf die Umweltprobleme Indonesiens aufmerksam machen und zeigen, wie es auch anders gehen kann. Ein Ort zum Ankommen und Träumen – erschaffen aus Abfall.

Katrin hat in Berlin Publizistik studiert und schreibt seit drei Jahren als Redakteurin im Lifestyle-Bereich. Wenn sie nicht gerade die weite Welt bereist, übt Katrin Kopfstand auf ihrer Yogamatte, oder ist auf der Suche nach den neuesten Innovationen und Health-Trends. Deshalb schreibt sie bei kronendach für die Rubriken Travel, Mindfulness und Zeitgeist. Nach Feierabend findet man sie meistens mit einer Matcha Latte in der Hand durch die Straßen Hamburgs spazieren.